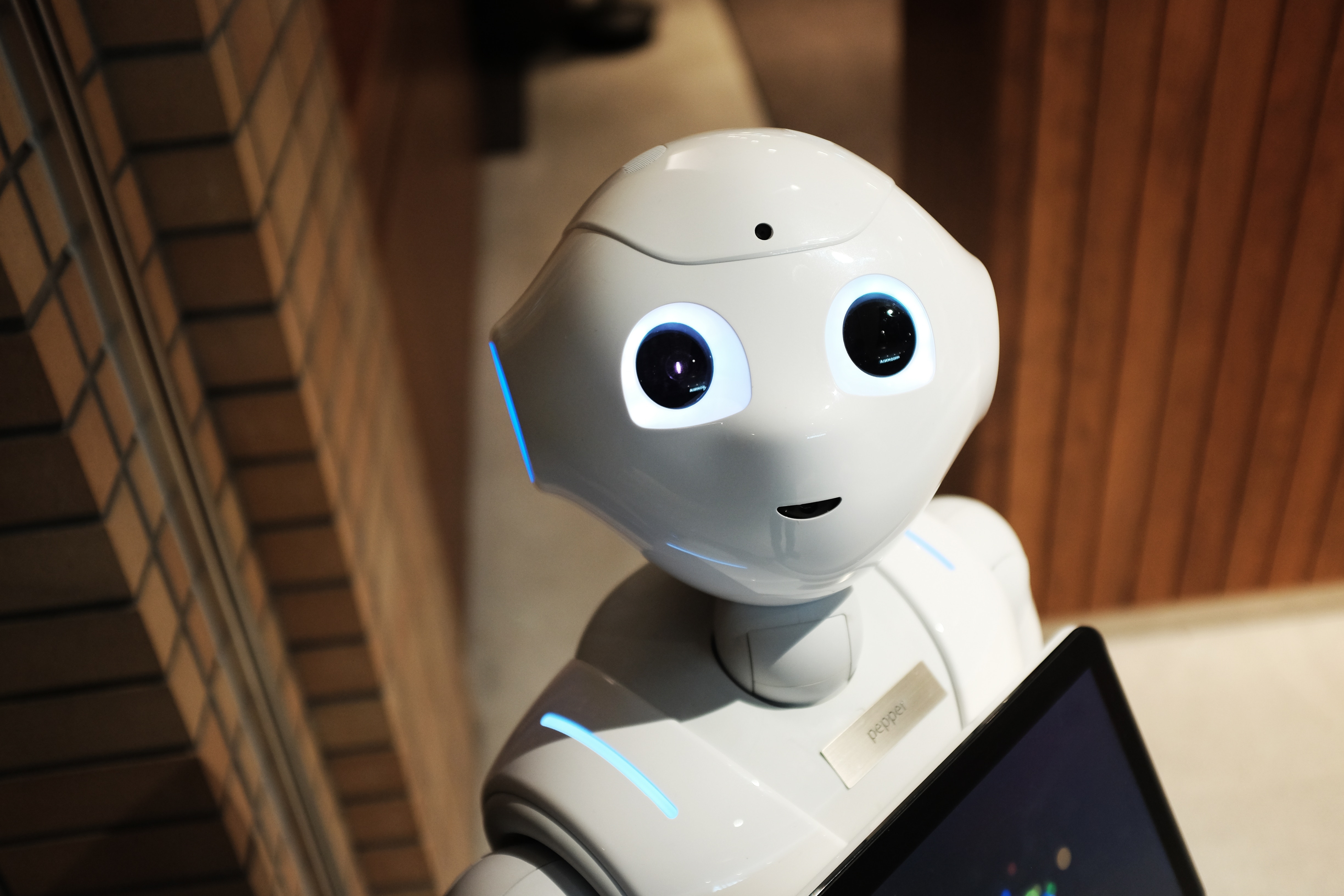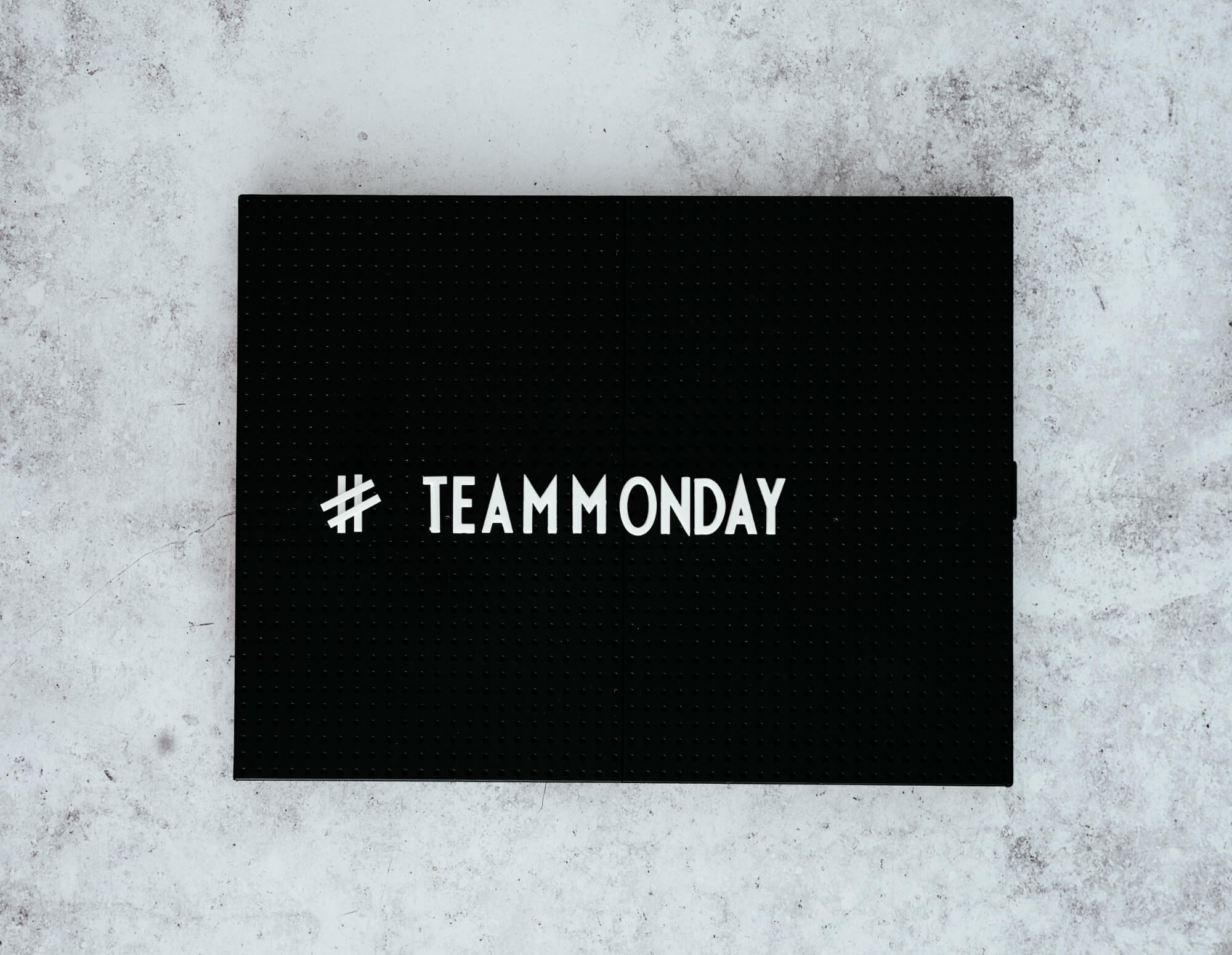Interview mit Prof. Dr. Stefan Ingerfurth von der SRH Fernhochschule – The Mobile University
Die SRH Fernhochschule – The Mobile University – ist eine Hochschule in privater Trägerschaft. Sie ist mit 21 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und bietet aktuell 32 berufs- und ausbildungsbegleitende Fernstudiengänge sowie 25 Hochschulzertifikate an.
Stefan Ingerfurth ist seit 2015 Professor für Allgemeine Betriebswirtschaft und seit 2018 Prorektor für Forschung & Hochschulentwicklung an der SRH Fernhochschule – The Mobile University. Er leitet die Studiengänge Betriebswirtschaft und Management (B.A.), Betriebswirtschaft und Digitalisierung (B.A.), Gesundheitsmanagement (B.A.) und Management (M.Sc.).
Der digitale Ansatz der SRH Fernhochschule hat mich dazu bewogen, Stefan Ingerfurth zu fragen, ob er sich ein Interview mit mir zum Thema „Digitales Lernen an der Hochschule“ vorstellen könnte. Die Mobile University war bereits vor Corona digital aufgestellt, umso relevanter ist der mobile und digitale Ansatz der Hochschule in diesen aktuellen Zeiten. Hier nun das Interview*:

Professor für Allgemeine Betriebswirtschaft und Prorektor für Forschung & Hochschulentwicklung
Melanie Hasenbein: Was zeichnet die Mobile University aus, wie mobil und digital ist Ihre Hochschule?
Stefan Ingerfurth: Als Mobile University sind wir so mobil wie unsere Studierenden, die oft neben dem Studium berufstätig sind, Familie haben oder Spitzensport betreiben. Unser Studium passt sich flexibel an und ermöglicht jedem, der es möchte, den Traum vom Studieren. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Qualität – wir wollen serviceorientiert für unsere Studierenden da sein. Jedem soll die Möglichkeit eines Studiums offenstehen: Unabhängig davon, in welcher Situation er sich befindet, wie alt er ist, ob er viel unterwegs ist oder sich im Ausland befindet. Mit unserem digitalen E-Campus und ergänzenden multimedialen Lerninhalten steht das Wissen jederzeit orts- und zeitungebunden zur Verfügung.
Melanie Hasenbein: Wenn ich versuche, mir ein Bild davon zu machen, da ist jemand, der ist beruflich viel unterwegs: kann der primär mobil studieren?
Stefan Ingerfurth: Ja, denn 90% unserer Studierenden absolvieren ihr Studium neben dem Beruf. Unser Studienkonzept basiert auf dem CORE-Prinzip, was für Competence Oriented Research and Education steht. Es geht darum, Kompetenzen zu erwerben und nicht nur das Wissen für die nächste Klausur abrufen zu können. Deshalb erarbeiten sich die Studierenden mithilfe der online bereitstehenden Materialien Kompetenzen, welche sie für ihren Berufsweg mitnehmen. Das bedeutet aber auch, dass die Klausur aus unserer Sicht nicht immer die beste Prüfungsform darstellt. In einigen Modulen werden noch Klausuren geschrieben, in anderen haben wir bereits alternative Prüfungsformen im Einsatz. Klassische Klausuren finden bei uns normalerweise vor Ort statt: Dafür bieten wir acht Mal im Jahr sogenannte Prüfungswochenenden an. An diesen kann die Klausur an einem unserer 21 Prüfungszentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz geschrieben werden. Ob und in welchem Zeit-Slot ein Studierender die Prüfung schreibt, kann er selbst flexibel wählen. Er kann entscheiden, wenn er sich bereit für die Klausur fühlt und sich dann für die Klausur in einem Prüfungszeitraum seiner Nähe anmelden.
Melanie Hasenbein: Und die anderen Prüfungsformen sind dann sowas wie Hausarbeiten, Präsentationen oder Cases?
Stefan Ingerfurth: Genauso ist es. Dafür haben wir ein Portfolio an verschiedenen Prüfungsformen, wo auch der ein oder andere Kollege mal etwas Neues ausprobiert. Ein Beispiel sind sogenannte Einsendeaufgaben, die recht häufig eingesetzt werden. Die Bearbeitung erfolgt zuhause. Einsendeaufgaben ähneln Hausarbeiten oder Seminararbeiten, es gibt hier aber kleinere Abschnitte, zum Beispiel drei Fragen, die man beantwortet und etwas anwenden muss, also eine Transferaufgabe leistet. Präsentationen finden bei uns als Onlinepräsentation statt. Das läuft so ab, dass Sie die Präsentation hochladen und dann ein Prozess startet. Sie bekommen einen Termin und präsentieren online mit Kamera in Adobe Connect. Für Studierende ist das realistische Szenario super, weil im beruflichen Kontext immer mehr online präsentiert wird. Entsprechend gut wird das Angebot auch von unseren Studierenden wahrgenommen.
Melanie Hasenbein: Ja, das ist gerade im Business-Kontext die Normalität. Da ist es super, dass man das entsprechend lernen und ausprobieren kann!
Stefan Ingerfurth: Das ist unser Anspruch, den wir auch mit dem CORE-Prinzip verfolgen. Es ist uns wichtig, dass die Studierenden Kompetenzen erwerben, die dann auch wirklich benötigt werden. Wir wollen nicht etwas prüfen, was rein theoretisch ist und nur in Lehrbüchern vorkommt. Natürlich achten wir trotzdem auf wissenschaftliches Arbeiten. Wir fördern dieses vor allem durch Hausarbeiten, reflektieren und kritisches Hinterfragen. Viele unserer Studierenden sind sehr ins Berufsleben eingebunden. Da ist es immer eine große Herausforderung, diejenige oder denjenigen von seiner täglichen Arbeit zu lösen und zu sagen: „Nimm mal die Vogelperspektive ein und schau‘ dir beide Seiten an, um pro und contra zu reflektieren.“ Das hilft vielen dabei, sich persönlich weiterzuentwickeln.
Melanie Hasenbein: Jetzt haben Sie gerade schon Adobe Connect erwähnt. Gibt es noch andere digitale Tools, die Sie an der Fernhochschule einsetzen?
Stefan Ingerfurth: Unser digitaler E-Campus ist die zentrale Kommunikationsplattform und das Kernstück des Studiums. Dort findet der Studierende alles, was er zum Studieren braucht. Dazu muss man verstehen, dass sich ein Fernstudium vom Studium an einer Präsenzhochschule unterscheidet. Man muss nicht vor Ort sein, um die nötigen Informationen zu bekommen. Bei uns gibt es als Basis für ein Modul immer einen oder zwei Studienbriefe, die inhaltlich alles enthalten, um das Modul bearbeiten zu können. Das ist das Fundament und dazu reichern wir viel an. Von Onlinevorlesungen, kleinen Videosequenzen, Quizfragen, Audio Abstracts bis hin zu interaktiven Veranstaltungen. Ein Audio Abstract ist wie in Hörbuch, nur kompakter. Es enthält die Zusammenfassung eines Studienbriefs in gesprochener Form – ideal für alle, die eher der auditive Lerntyp sind. Unsere Onlinevorlesungen werden mit dem Tool Panopto aufgezeichnet und können immer wieder angesehen werden. Zusätzlich kann der Studierende Lesezeichen oder einen Zeitstempel setzen, mit dem wieder zu dem Kapitel gesprungen werden kann. Unsere interaktiven Veranstaltungen führen wir mit Adobe Connect durch. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass Onlinesprechstunden oder ein Onlineaustausch besser angenommen werden als eine Onlinevorlesung. Nicht jeder traut sich in einer Onlinevorlesung, eine Frage zu stellen und es gibt sowieso eine Aufzeichnung, die man sich anschauen kann. Wenn man dagegen online zum Austausch zusammenfindet, nehmen in der Regel viele teil und es werden direkt Fragen gestellt.
Melanie Hasenbein: Wie hat sich die Rolle als Professor mit der fortschreitenden Digitalisierung verändert?
Stefan Ingerfurth: Die Art des Studierens ist eine andere, als ich noch studierte. Wir als Professoren sehen uns als Lernbegleiter und nicht als die Person, die der einzige Wissensträger ist und ein Geheimnis hütet. Diese Zeiten sind mit der Digitalisierung, welche eine jederzeitige Verfügbarkeit von Informationen mit sich bringt, vorbei. In Onlinesprechstunden, eins-zu-eins Sprechstunden, Telefonaten und via E-Mail stehen wir in einem ständigen Austausch mit unseren Studierenden.
Melanie Hasenbein: Das ist ein spannender Ansatz. Zudem geht es ja überall immer mehr in diese Richtung. Wie sieht es mit Präsenzveranstaltungen aus?
Stefan Ingerfurth: Präsenzveranstaltungen bieten wir immer als freiwillige Ergänzung an und haben auch eine gewisse Nachfrage. Deshalb bauen wir unsere Studienzentren, in denen diese Veranstaltungen stattfinden, weiter aus. Trotz steigender Studierendenzahl bleibt die Anzahl der Präsenzveranstaltungen konstant oder sinkt sogar leicht. Das spricht dafür, dass Angebote vor Ort weniger wahrgenommen werden. Je nach Studiengang variiert das, Psychologiestudierende kommen zum Beispiel tendenziell eher zu den Veranstaltungen vor Ort.
Melanie Hasenbein: Wie viele Präsenzveranstaltungen führen Sie selbst pro Jahr noch durch?
Stefan Ingerfurth: Das kann ich selbst ein bisschen steuern. Typischerweise biete ich einmal pro Monat ein Wochenende mit Präsenzveranstaltungen an. Da stehe ich aber nicht von Freitagnachmittag bis Samstagabend vorne und gebe Input, sondern gestalte das sehr interaktiv. Es soll den Studierenden helfen und die Teilnahme soll sich lohnen. Das umfasst nicht nur die Weitergabe von Wissen, sondern auch sich weiterzuentwickeln und ganzheitlich zu verstehen. Viele meiner Veranstaltungen mache ich jedoch in der Onlinebegleitung.
Melanie Hasenbein: Geht es damit bei Ihnen komplett weg von der klassischen Vorlesung?
Stefan Ingerfurth: Als Prorektor der Mobile University sage ich ganz klar: Ja. Natürlich muss jeder Professor oder Dozent selbst abwägen, welches Format zur Vermittlung seiner Inhalte am besten geeignet ist. Der Wunsch ist allerdings schon, dass die alternativen Lehrformate der klassischen Vorlesung vorgezogen werden.
Melanie Hasenbein: Wie kommen denn die Studierenden mit dem mobilen und selbstgesteuerten Lernen zurecht? Ich kann mir vorstellen, dass es manchen recht leichtfällt, so selbstständig zu lernen. Andere haben sicherlich auch Schwierigkeiten damit, sich selbst zu motivieren und dranzubleiben. Gibt es da Unterstützungsmöglichkeiten?
Stefan Ingerfurth: Da uns Qualität sehr am Herzen liegt, unterstützen wir unsere Studierenden jederzeit – nicht nur mit Materialien, sondern auch in der Betreuung. Unsere Studierendenbetreuung hilft bei allen organisatorischen Fragen rund ums Studium, alle inhaltlichen Fragen beantworten unsere Professoren und Dozenten. Dafür müssen die Studierenden allerdings aktiv sein und unsere Betreuung auch wollen.
Melanie Hasenbein: Können Sie über die Zielgruppe der Studierenden eine Aussage treffen, wie viele berufstätig, wie viele Anfänger sind?
Stefan Ingerfurth: Über 90% unserer Studierenden sind berufstätig.
Melanie Hasenbein: Hat die Mobile University Studiengänge, die verstärkt digitale Inhalte behandeln? Gibt es ein paar Beispiele, die Sie nennen können, welche die Studierenden auf diese digitalisierte Zeit vorbereiten?
Stefan Ingerfurth: Unseren Masterstudiengang Digital Management & Transformation, welcher einen grundständigen Bachelorstudiengang voraussetzt. Im Bachelorbereich sind es die Studiengänge „Betriebswirtschaft und Management“ und „Betriebswirtschaft und Digitalisierung“. Seit Ende letzten Jahres werden die beiden betriebswirtschaftlichen Bachelorstudiengänge mit digitalen Inhalten durch zwei Bachelorstudiengänge im Informatikbereich verstärkt: „Wirtschaftsinformatik“ und „Web- und Medieninformatik“. Darüber hinaus überlegen wir auch in unserer weiteren Planung, was wir noch im digitalen Bereich anbieten können. So gibt es mittlerweile einen MBA, der die Vertiefung Digitalisierung beinhaltet. Ich bin fest davon überzeugt, dass Digitalisierung in Zukunft ein Grundlagenmodul wird, so wie wissenschaftliches Arbeiten.
Melanie Hasenbein: Was glauben Sie, wo es hingeht mit der Digitalisierung, der Künstlichen Intelligenz und der virtuellen Realität? Was sind da mögliche Zukunftsszenarien?
Stefan Ingerfurth: Wir als Hochschule beschäftigen uns eingehend mit den angesprochenen Themen. Es ist natürlich immer schwer, zu antizipieren, was technisch und digital kommen wird. Ich persönlich denke, dass künstliche Intelligenz schleichend Teil unseres Alltags wird, aber vielleicht nicht so, wie wir uns das bisher vorstellen. Künstliche Intelligenz könnte ein weiteres Tool werden, wie und womit man lernt.
Melanie Hasenbein: Was glauben Sie, wofür der Mensch zukünftig da sein wird?
Stefan Ingerfurth: Künstliche Intelligenz wird kommen und die Digitalisierung wird weiter voranschreiten, das ist sicher. Aber was eine Maschine nicht kann, sind Emotionen und Kreativität zu erbringen. Eine Maschine kann keine Empathie gegenüber Studierenden oder anderen Personen transportieren. Sie wird nur da unterstützen, wo es rechnerisch richtig ist – es kann aber in einer anderen Situation trotzdem nötig sein. Der Mensch wird immer eine Steuerungsfunktion haben. Die Gedanken, die sich eine Hochschule machen sollte, sind eher, ob es zukünftig noch Abschlüsse braucht und dieses Geschäftsmodell zukunftsfähig ist. Ist ein Abschluss an sich eine Garantie dafür, dass man für etwas die Kompetenz hat? Oder geht es vielmehr darum, dass man etwas gelernt, mit Wissen angereichert und somit eine Kompetenz erworben hat? Ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen, auch wenn es möglicherweise noch eine ganze Weile so bleiben wird, wie es ist.
Melanie Hasenbein: Das führt mich zu einem weiteren Punkt, den Dozenten und Professoren. Was brauchen diese, was sollten sie mitbringen?
Stefan Ingerfurth: Professoren brauchen eine Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Das ist auch unabhängig von der Lehre für jeden essenziell, kann aber auch eine große Herausforderung darstellen: Lebenslanges Lernen, offen für Neues sein und sich nicht vor Veränderungen verschließen.
Melanie Hasenbein: Gibt es abschließend noch eine Botschaft oder etwas, das Sie mitgeben wollen im digitalen Wandel?
Stefan Ingerfurth: Keine Angst davor zu haben. Das Thema wird mit seinen Gefahren und Risiken stärker wahrgenommen als die guten Sachen, die damit einhergehen. Der digitale Wandel bietet viele Chancen und Möglichkeiten, die genutzt werden können. Es wird auch weiterhin eine große Herausforderung sein, richtiges von falschem Wissen zu unterscheiden und Fake News als diese zu erkennen. Darauf können wir uns nicht vorbereiten, aber man kann lernen zu reflektieren und zu hinterfragen.
Melanie Hasenbein: Vielen Dank.
Stefan Ingerfurth: Gerne.
*Das Interview wurde bereits vor der COVID-19-Pandemie aufgenommen.